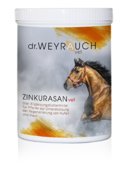Zink - essentiell in der Pferdefütterung
Das lebensnotwendige Spurenelement Zink ist der Schlüssel zu einem gesunden Stoffwechsel
Mit dem Spurenelement Zink verbindet der Pferdehalter glänzendes Fell, gute Hufe und ein gesundes Immunsystem. Mit Recht, denn Zink ist ein Schlüsselelement, das in viele Stoffwechselprozesse des Körpers eingreift.
Seit den 90iger Jahren wurden von Frau Dr. Weyrauch erste redaktionellen Beiträge zu dem wirklich erstaunlichen Thema Zink in der Pferdefütterung verfasst, die bis heute nicht an ihrer Aktualität verloren haben.
Zeitgleich mit dem Auftreten von BSE und dem Verbot der Tiermehlfütterung kam es zu eine großen Wandel in der Mineralisierung bei Pferden. Die Spurenelemente, die naturgemäß in relativ hoher Dosierung im Tier- und Blutmehl enthalten sind fehlten ab da in den damals üblichen Mineralfuttern und damit auch in der Fütterung. Nährstoffmängel wie Huf- und Hautprobleme begannen sich zu häufen.
So wurde das breite Wirkspektrum von Zink, dessen große Bedeutung damals bislang nur im Human- und Nutztierbereich bekannt war, den Pferdefreunden nahegebracht. Dass Zink nicht nur zu einer besseren Wundheilung beiträgt oder ein wesentlicher Faktor bei der Bekämpfung des Sommerekzems und des damit verbundenen Juckreizes darstellt, sondern dass die Bedeutung von Zink im Stoffwechsel des Pferdes und aktiv im Bereich von Entgiftungsvorgängen von größerer und gewaltiger Natur ist als man sich das vorstellen wollte wurde publik.
Um diesem lebenswichtigen Spurenelement gerecht zu werden, werfen wir einen Blick auf Vorkommen, Bedarf und Bedeutung von Zink.
Zink vor allem in Augen, Haut und Leber lokalisiert
Tatsächlich ist dieser Mikronährstoff, von dem man im ausgewachsenen Pferdekörper nur 12 bis 15 Gramm findet, vorwiegend in der Haut, dem Fell, den Augen, der Leber und Bauchspeicheldrüse sowie Hoden und Sperma lokalisiert.
Als Bestandteil von circa 230 Enzymen steuert Zink als Cofaktor viele lebensnotwendige Stoffwechselvorgänge. Bereits vor der Zeugung von Leben kommt Zink eine große Bedeutung zu. Das Spurenelement ist für die Bildung von körpereigenen Hormonen (zum Beispiel Geschlechtshormonen), für die Samenreifung beim Hengst und für die Einnistung des befruchteten Eies in die Gebärmutterschleimhaut der Stute unentbehrlich.
Die Synthese von Vitamin A aus ß-Carotin im tierischen Stoffwechsel ist ebenso zinkabhängig, was erklärt, das die Spurenelementversorgung offensichtlich vor der Vitaminversorgung für die Verbesserung der Gesundheit der Gebärmutter, die Einnistung des Eies und damit die Empfängnisfähigkeit von Stuten vorrangig ist.
Zink als Wachstumsfaktor
Aber nicht nur für die Fruchtbarkeit, sondern auch für das anschließende Wachstum ist Zink wesentlich. So können Lebewesen mit einem vorliegenden Zinkmangel nicht in ihre genetisch vorbestimmte Größe wachsen und bleiben ab einem gewissen Alter (Menschen 21 Jahre, Pferde 7 Jahre) für immer klein.
Zink ist vonnöten für die Ausbildung der Wachstumshormone, das Längenwachstum des Knochens und für die allgemeine Zellneubildung. Dazu zählt auch die Entwicklung von Haar-, Haut- und Hornzellen, da Zink die Bildung von Keratin, der Eiweißverbindung, aus der Haar und Hufhorn bestehen, befördert.
Die gesunde Entwicklung der Darmschleimhaut, welche die größte zusammenhängende Schleimhautfläche des Körpers darstellt, ist mit ausreichend Zink gesichert, so dass sich deren Zellen innerhalb von 3 bis 5 Tagen vollständig erneuern können. Ohne eine ausreichende Zinkzufuhr verliert die Darmschleimhaut ihre Fähigkeit, ausreichend Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei zu resorbieren.
Zink - Basis für ein funktionierendes Immunsystem
 Zink ist beteiligt an der Produktion von Immunabwehrzellen, die im Blut und der Lymphe krankmachende Erreger wie Bakterien, Viren und Pilze in Schach halten. Daher ist nicht selten der Zinkspiegel nach schweren Infektionen verringert.
Zink ist beteiligt an der Produktion von Immunabwehrzellen, die im Blut und der Lymphe krankmachende Erreger wie Bakterien, Viren und Pilze in Schach halten. Daher ist nicht selten der Zinkspiegel nach schweren Infektionen verringert.
Aber auch umgekehrt gilt: Ein Zinkmangel kann zu einer Schwächung des Immunsystems beitragen und damit Tür und Tor für Bakterien, Viren und Pilze öffnen. Die Bedeutung von Zink spielt gerade bei Herpesinfektionen eine überaus große Rolle.
Zink trägt zur Kräftigung der körperlichen Immunabwehr über die Bildung von T-Lymphozyten in der Thymusdrüse sowie über den Aufbau und die Regeneration der Lungen-, Darm und Gebärmutterschleimhaut bei. Eine Beeinträchtigung der regenerativen Kraft der Schleimhäute durch den Zinkmangel verzögert entsprechende Heilungen.
Typisch für den Zinkmangel bei Fohlen und Jungpferden sind die "Fohlenwarzen", die mit einer Gabe eines hochwertigen Zinkpräparats schnell verschwinden (siehe Bild oben).
Gute Sicht - Zink als wesentlicher Faktor für das Auge
Das Auge weist ungewöhnlich hohe Zinkkonzentrationen auf, so dass sich ein Mangel an Zink direkt in einer Sehschwäche äußern kann. Fohlen werden blind oder ohne Augen geboren. Auch bei der Periodischen Augenentzündung ist an die bedarfsgerechte Zinkzufuhr zu denken. Die Verstoffwechselung von Vitamin A, dem „Sehvitamin“ ist zinkabhängig, so dass die alleinige Zufuhr von ß-Carotin für besseres Sehen oder die Fruchtbarkeit nur begrenzten Sinn macht.
Eine bedarfsgerechte Zufuhr an Zink an Jungpferde unterstützt die Sehfähigkeit und beugt Augenerkrankungen sowie Schlechtsichtigkeit vor.
Nicht selten erkennen Pferde "Gefahren", die bei näherem Hinsehen keine sind. Daher gilt die Empfehlung, gerade bei schreckhaften, „geistersehenden“ Pferden die Zinkzufuhr dem Bedarf anzupassen.
Abgesehen davon macht ein Zinkmangel hippelig, unkonzentriert und nervös. Er führt beim Menschen bis in die Schizophrenie.
Der tägliche Bedarf muss gedeckt werden
 Laut offizieller Angaben wurde der Zinkbedarf mit 35 bis sogar 40mg Milligramm pro Kilogramm Trockenmasse festgelegt. Frisst ein 600 Kilogramm schweres Pferd in Arbeit täglich sieben Kilogramm Heu und vier Kilogramm Hafer, so beträgt die Trockenmasssaufnahme zehn Kilogramm am Tag, der Bedarf für Zink läge also bei 350 Milligramm pro Tag. Mit einer vermehrten Aufnahme von Futter, zum Beispiel Heu, steigt der Bedarf an Zink. Durch die Tendenz, getreidefrei zu füttern, sinkt die Zufuhr an Zink.
Laut offizieller Angaben wurde der Zinkbedarf mit 35 bis sogar 40mg Milligramm pro Kilogramm Trockenmasse festgelegt. Frisst ein 600 Kilogramm schweres Pferd in Arbeit täglich sieben Kilogramm Heu und vier Kilogramm Hafer, so beträgt die Trockenmasssaufnahme zehn Kilogramm am Tag, der Bedarf für Zink läge also bei 350 Milligramm pro Tag. Mit einer vermehrten Aufnahme von Futter, zum Beispiel Heu, steigt der Bedarf an Zink. Durch die Tendenz, getreidefrei zu füttern, sinkt die Zufuhr an Zink.
Hochtragende Zuchtstuten haben eine Bedarf von 680 Milligramm am Tag (90 Milligramm je 100 Kilogramm Lebensmasse). Allerdings muss dazu gesagt werden, dass diese Werte sehr niedrig angesetzt sind und nicht geeignet, den Bedarf in Stress-Situationen oder bei Krankheit zu decken. Ganz besonders gilt dies, wenn die Futterqualität nicht optimal ist und hohe Anflutungen an körperfremden Substanzen (Medikamente, Giftstoffe, Aromastoffe etc.) Leber und Darm belasten.
Hier leistet nämlich das Spurenelement Zink im Rahmen von verschiedenen Entgiftungsprozessen gerade beim Pferd große Arbeit. Der Zinkbedarf ist also auch zusätzlich abhängig von der Qualität der Fütterung. Die dazu erforderliche Zinkmenge ist abhängig von der Schwere der Qualitätseinbußen im Grundfutter.
Deckung des Zinkbedarfs
Ausgehend von einer Heu- bzw. Weidefütterung kann von einer Trockensubstanzaufnahme von 1,2 Kilogramm Heu bzw. Weidegras pro 100 Kilogramm Körpermasse ausgegangen werden. Der Gehalt an Zink im Heu betrug in den 70iger Jahren noch etwa 28 Milligramm pro Kilogramm, heute jedoch sind Werte über 22 Milligramm pro Kilogramm Trockenmasse Heu eher üblich.
Das heißt, dass ein 600 Kilogramm schweres Pferd den Zinkbedarf mit Heu alleine nicht decken kann. Das ist problematisch, da die Heufütterung derzeit sehr beliebt ist und immer weniger Hafer (Getreide mit dem höchsten Zinkgehalt, etwa 35 Milligramm pro Kilogramm Trockenmasse) gefüttert wird. Gerste und Mais enthalten nur rund 30 Milligramm pro Kilogramm. Aber wer füttert seinem Pferd heutzutage noch mehr als drei Kilogramm Hafer pro Tag?
Handelsübliche Müsli- oder Pelletfutter verfügen nur selten Zinkgehalte über 120 Milligramm pro Kilo und dienen nur dazu, den Mindestbedarf an Zink zu decken.
Zinkbedarfsdeckung bei Pflanzenfressern
Zu erwähnen bleibt, dass die Verfügbarkeit von Zink aus pflanzlicher Nahrung deutlich begrenzt ist und nicht selten an unlösliche Phytate gebunden ist. Da das Pferd von Natur aus ein reiner Pflanzenfresser ist, besteht immer die Gefahr eines latenten Zinkmangels, was eine hochwertige Mineralisierung begründet sofern eine verbesserte Lebensqualität , wie zum Beispiel im Fellwechsel oder zur Stärkung des Immunsystems angestrebt wird.
Merke auch: Anorganische Verbindungen stören die Zinkresorption.
Stress und schlechte Heuqualitäten als Zinkräuber
Stress ist ein wahrer Zinkräuber. Stress entsteht bei Pferden während der Ausbildung, in Wettkampfsituationen, aber auch durch falschen Umgang. Körpereigenes Cortison wird ausgeschüttet, welches als natürlicher Gegenspieler zu Zink betrachtet wird.
Zink geht weiterhin über den Schweiß, über Blut und über Wundwasser verloren (Operationen, Geburten, starker Mückenbefall).
Der Bedarf von Zink steigt in Phasen, in denen der Stoffwechsel aus verschiedenen Gründen Entgiftungsvorgänge forcieren muss. Zink ist hier Cofaktor bei der enzymatischen Entsorgung von Giftstoffen (Umwandlung von fettlöslichen Giften in wasserlösliche Gifte für den Transport über Harn und Galle).
Zinkmangelsymptome deutlich angezeigt
Der Einfachheit halber ist hier zu bemerken, dass sich im Gegensatz zu vielen anderen Nährstoffen ein Zinkmangel auch vom Laien äußerlich sehr leicht diagnostizieren lässt.
Zinkmangelsymptome treten vorzugsweise in Zeiten des Fellwechsels auf. Der Zinkmangel äußert sich dabei höchst individuell. Klassische Zinkmangelsymptome sind Haut- und Haarprobleme, beginnend mit mattem Haarkleid (bei Rappen oft in Form von Schuppenbildung zu erkennen), Schweifjucken, bis hin zum Sommerekzem. Typisch für den Zinkmangel ist vor allem der Juckreiz.
Im Bereich des Horns treten Huffäule und Hufwachstumsstörungen auf.
Der Zinkmangel äußert sich ebenso in Form von Infektanfälligkeit, Abmagerung und Appetitlosigkeit, sowie schlechter Wundheilung.
Sich wiederholende Erkältungskrankheiten und Mauke können ebenfalls auf ein Zinkdefizit hinweisen.
Dazu gehören ebenso Viruserkrankungen (z.B. auch Herpes, Warzenbildung). Auch die Unfruchtbarkeit bei Hengsten (zu geringe Samenqualität und -dichte) kann u.a. mit einem Zinkmangel in Verbindung gebracht werden.
Im Zinkmangel werden nicht nur spezifisch die Gehalte an Zink in den Geweben beeinflußt, sondern auch die Konzentrationen und teilweise Gehalte anderer Spurenelemente, so daß die für Zink typischen extremen Mangelsymptome nicht nur durch Fehlen von Zink selbst, sondern auch durch die veränderten Gewebekonzentrationen anderer Elemente hervorgerufen werden könnten (H.-P. Roth, M.Kirchgessner, 1977).
Erhöhter Zinkbedarf und Zinkverluste
Ein erhöhter Bedarf an Zink ist in Zeiten des Haarwechsels festzustellen, in Stresssituationen und durch Transporte, sowie bei Infektionskrankheiten.
Eine beachtliche Zinkzufuhr ist nötig in der Zeit der Trächtigkeit und Laktation. Dabei nimmt sich das ungeborene Fohlen Zink aus den Zinkreserven der Stute. Zu hohe Zinkgaben im Vergleich zu Mangan und Kupfer im letzten Trächtigkeitsdrittel lassen die Fohlen oft zu groß wachsen.
Daher ist die Zinkfütterung vorwiegend bei der güsten Stute und in der frühen Trächtigkeit zu beachten, wobei die Verhältnismäßigkeit unter den Spurenelementen beachtet werden muss.
Wird die Stute in der Laktation mit hohen Zinkdosen gefüttert, wird Zink im Gegensatz zu Mangan, Kupfer oder Eisen dem Fohlen durch die Milch sofort weitergegeben. So können immunlabile Saugfohlen über die mit Zink gefütterte Mutter durch die Muttermilch gezielt stabilisiert werden.
Durch Hautverletzungen, Geschwüre und Operationen werden große Mengen an Zink durch das Blut und Blutserum (z.B. Wundwasser) ausgeschwemmt. Durch teilweise erhöhte Zufuhren an hochwertigen Zinkverbindungen lässt sich die Wundheilung beschleunigen und Infekten vorbeugen.
Fellwechsel, starker Juckreiz bei Sommerekzem und schlecht heilende Wunden sind nur einige Gründe, um mit Zinkpräparaten rasch Zinkdefizite auszugleichen.
Zur grundsätzlichen Zinkversorgung sollte ein entsprechend hochqualitatives Mineralstoffpräparat gewählt werden, um langfristig keine Ungleichgewichte im Bereich der Spurenelementzufuhr zu erzeugen.
Zinkaufnahme ins Gewebe sichern
Je größer ein vorhandener Zinkmangel ist, desto leichter ist er unabhängig von der Bindungsform des Zinks auszugleichen.
Je subtiler der Zinkmangel wird, desto mehr spielt die chemische Verbindung, in der das Zink gebunden vorliegt, eine Rolle. Hier kommt ausserdem dem Trägermaterial, in dem die Zinkverbindung angeboten wird, eine extrem hohe Bedeutung für die Bioverfügbarkeit zu.
Diese Umstände werden deutlich, wenn ein Pferd zwar rein rechnerisch hohe Mengen Zink durch Ergänzungsfutter und Mineralfutter zugeführt bekommt, aber dennoch rein optisch ein Zinkmangel besteht.
Dabei zählen die preislich günstigen Verbindungen Zinkoxid und Zinksulfat zu den am schlechtesten resorbierbaren Verbindungen. Sie gelangen zwar durchaus ins Blut, ihre Aufnahme ins Gewebe bleibt jedoch fraglich.
Zudem können große Mengen von Zinksulfat die Verdauung (Übelkeit, Durchfall, Reizung der Darmschleimhaut) beeinträchtigen. Besser verfügbar sind Zinkchelate. Aber selbst bei den Zink- Aminosäure-Chelaten sind große qualitative Unterschiede möglich. Hier spielt vor allem die ph-Beständigkeit im Verdauungstrakt eine große Rolle. Das heißt, die Verbindung sollte bis in die Zellen stabil bleiben, unabhängig vom sauren Magen bis in den basischen Dünndarm.
Solche Verbindungen sind zwar wesentlich teuer, die Wirkung ist jedoch gesichert.
Überdosierungen unproblematisch
Je hochwertiger die Zinkverbindung ist, desto schneller kann auch mit einer kleineren Dosierung ein Mangel ausgeglichen werden. Ein weiterer Vorteil qualitätvoller Zink- Aminosäure-Chelate ist, dass so Verdrängungsreaktionen, insbesondere die Verschiebung des Zink/Mangan- oder Zink/Kupfer- Verhältnisses in Grenzen gehalten werden können. Im Gegensatz dazu kann es durch die Zufütterung hoher und einseitiger Zinkmengen zu einer Störung des Mineralstoffgleichgewichts kommen, die sich nachteilig auf z.B. den Kupfer- oder Manganhaushalt auswirkt.
Die Gabe von Zinkpräparaten kann durchgängig erfolgen, wenn die Grundmineralisierung gesichert ist. Eine hoch bis sogar höchstdosierte kurmäßige Zinkzufütterung von 4 bis 8 Wochen ist unproblematisch und erfolgt im Allgemeinen im Fellwechsel, nach Operationen, Blutverlusten und zur Verbesserung der Wundheilung.
Dr. Susanne Weyrauch - Wiegand 2012 überarbeitet 2025©